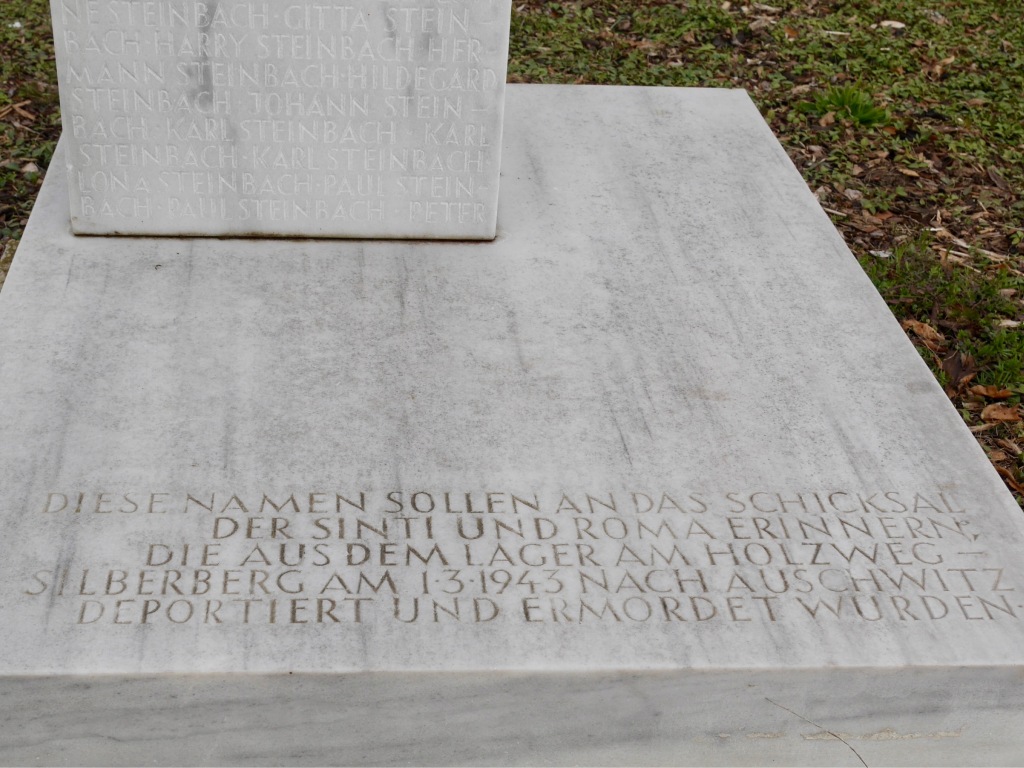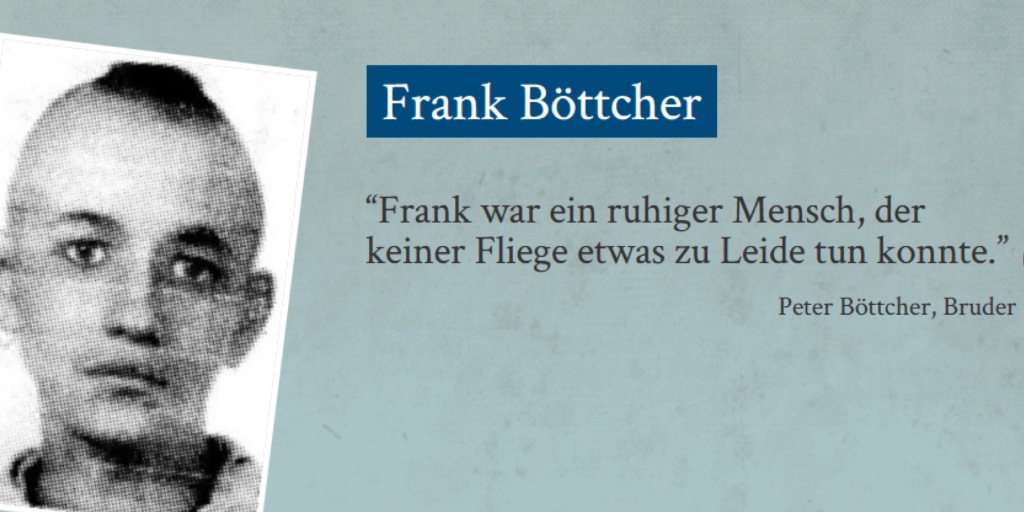Migrantische Perspektiven auf die „Himmelfahrtskrawalle“
Vor 30 Jahren, am 12. Mai 1994, dem Himmelfahrtstag, jagten Dutzende bewaffnete Neonazis stundenlang Migrant*innen durch die Magdeburger Innenstadt und prügelten auf sie ein. Der Tag war einer der traurigen Höhepunkte der gewalttätigen „Baseballschlägerjahre“ in Ostdeutschland. Die damaligen pogromartigen Ausschreitungen erschütterten (nicht nur) Magdeburg und machten weltweit Schlagzeilen. Sie gingen unter dem Namen „Himmelfahrtskrawalle“ in die neueste Geschichte Deutschlands ein.
Der „Verein Nachbarschaftliches Cracau-Prester“ hat im Nachgang der rassistischen Angriffe Aussagen von Zeug*innen gesammelt und anonymisiert in einer Broschüre veröffentlicht. Zum heutigen 30. Jahrestag der Ereignisse veröffentlichen wir Aussagen von Migrant*innen zu den Geschehnissen am 12. Mai 1994, die wir dieser Broschüre und den im Internet zugänglichen Medienberichten entnommen haben – ohne Anspruch auf Vollständigkeit oder Ausgewogenheit, sondern zur Erinnerung der Ereignisse und zur Wahrnehmung der migrantischen Perspektive.
„Ich war allein. Da hörte ich vom Karstadt her Rufe ‚Ausländer raus!‘. Ich sah Leute weglaufen. Ich sah auch an der Ecke vom Breiten Weg auf der Karstadt-Seite Leute mit Baseballschlägern und Plastikknüppeln.“
„Als ich die Straße bei der Ampel in Höhe der Johanniskirche überquerte, war da ein Polizeimann. Der hielt mich fest, riß mich am Hemd.“
„Zwei junge Schwarze, die wohl von den Vorfällen nichts wußten und gerade aus Mc Donald’s herauskamen, wurden sofort von den Rechtsradikalen angegriffen und alle Leute, die beim Café Flair saßen, mischten sich in das Gewühl ein. Plötzlich wurde wir auch von Rechtsradikalen umgeben vor den Augen der Polizei.“
„… es gelang ihnen sogar, die Scheiben der Straßenbahn, in der wir uns befanden zu zerschlagen und uns mit Steinen zu bewerfen.“
„Draußen … saßen deutsche junge Männer auf der Terrasse … Als wir vorbeigingen standen die auf und riefen u.a.: Ausländer raus! Dann ging alles ganz schnell: Die Nazis hatten Knüppel und ein paar warfen mit den Stühlen nach uns.“
„Wir wollten in einem Taxi fliehen und wurden nicht mitgenommen.“
„Niemand hat uns geholfen. Nicht die Polizei, nicht die Bürger von Magdeburg.“
„Seit Donnerstag wissen wir: Es kann jederzeit passieren, am hellichten Tag. Wir könnten getötet werden und keiner würde uns helfen.“